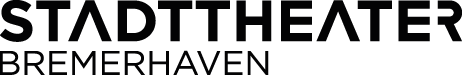Humor als Bewältigungsstrategie
Sein oder Nichtsein zählt neben Charlie Chaplins Der große Diktator zu den bekanntesten Komödien, die sich noch während des 2. Weltkrieges in den 1940er Jahren über das deutsche Reich, den Nationalsozialismus und Hitler lustig machen. Durch eine humorvolle Perspektive verarbeiten sie den Schrecken, die die Nazis verbreiteten.
In der Komödie von Nick Whitby, die auf Ernst Lubitschs berühmten Filmklassiker basiert, der wiederum das Theaterstück Noch ist Polen nicht verloren von Melchior Lengyel als Grundlage nutzte, kämpft das Ensemble des Polski Theaters gemeinsam mit viel Witz und schauspielerischem Talent gegen die Nazis, die Polen 1939 überfallen. Im vorauseilendem Gehorsam, aus Angst vor dem Hitlerregime, weist die polnische Regierung das Polski Theater an, ihre antifaschistische Komödie vom Spielplan zu nehmen. Das Theater hat keine andere Wahl und spielt stattdessen Hamlet. Als die Nazis dann Polen einnehmen, sich ausbreiten und die polnische Untergrundbewegung auslöschen wollen, kann das Ensemble aber auf die langerprobten und überzeichneten Nazi-Rollen aus ihrer abgesetzten Komödie zurückgreifen und führt so die Gestapo kreativ und erfolgreich an der Nase herum.
Die Figuren laden in ihrer Überzeichnung, mit ihren durchaus alltäglichen Problemen und dem manchmal widersprüchlichen Verhalten, zum Schmunzeln ein. Da wäre zum Beispiel Konzentrationslager-Erhardt, der mit seinem starken Übergewicht zu kämpfen hat und trotzdem ununterbrochen futtert oder Professor Silewski, der als Doppelagent in seiner Rolle als polnischer Air Force Mitarbeiter nicht gut genug vorbereitet ist, weil er die polnische Schauspielerin Maria Tura nicht kennt und so ziemlich schnell als Spion der Gestapo auffliegt.
Sich an das Thema des Nationalsozialismus humoristisch anzunähern ist ein Drahtseilakt, schließlich sind durch die Gräueltaten der Nazis Millionen von unschuldiger Menschen, insbesondere Juden, ermordet worden. Lubitsch, der selbst gebürtiger deutscher Jude war, aber kein Opfer des Nationalsozialismus wurde, da er in den 1920er Jahren in die USA auswanderte, um sich in Hollywood als Regisseur zu etablieren, wagte dieses riskante Experiment und wurde dafür nicht nur gelobt, sondern durchaus auch kritisiert. Sein oder Nichtsein sei Geschmacklos und Verharmlosend warfen die Kritiker Lubitsch vor. Da stellt sich zum einen die Frage: Was darf Humor? Und zum anderen: Was kann Humor?
«Glauben Sie mir, das wird ein Lacher.»Grünberg in «Sein oder Nichtsein»
Humor erzeugt Distanz zu Ereignissen und nimmt somit einen Teil der Schwere und Last. Insbesondere Satire schafft es durch Überzeichnung und Absurdität vor allem politische Vorgänge und Situationen vorzuführen und so die Schwächen aufzudecken. Lubitsch zeichnet in seiner Komödie die Figuren grotesk und einfältig und nimmt ihnen dadurch die angsteinflössenden Charakterzüge. Er schafft es, durch die Form der Satire die gesamte Gestapo-Maschinerie lächerlich zu machen und vorzuführen. Eine Vorgehensweise, die ermutigt und selbstermächtigt.
Selbstermächtigung findet auch statt, indem mithilfe von Humor ein System im Kern angegriffen wird. Es kann hinter die Fassade geschaut werden und das «Dahinter» kann als leer und nichtig entlarvt werden. Durch die übertriebene Inszenierung der Nazis wird klar, dass Macht eine pure Maskerade ist und, dass hinter den Uniformen, den Märschen, der Gestik und der gesamten «Show» wenig fundierter Inhalt steckt. Humor deckt Widersprüche und Sinnlosigkeit auf. Indem ein polnischer Schauspieler sich in eine Uniform wirft und absurde Inhalte reproduziert, aber trotzdem von den realen Nazis ernst genommen wird, werden nicht nur oberflächliche Selbstinszenierungsstrategien offen gelegt, sondern auch die Einfältigkeit, die hinter diesen Strategien steckt. Was bleibt, ist ein Haufen beschränkter Nazi-Figuren, die ein haltloses politisches System als bloße Marionetten vertreten.
Humor kann und soll aber vor allem eins: Menschen zum Lachen bringen und Lachen hat ganz wunderbare Eigenschaften. Wenn wir lachen entspannt sich unser Nervensystem und wir können loslassen. Ängste lösen sich auf und im Moment des Lachens geben wir die Kontrolle ab. Zudem, das haben wir sicher alle schon einmal erlebt, ist Lachen ansteckend und schafft so Gemeinschaft. Es entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl und eine mögliche Hilflosigkeit gegenüber schwerer Situationen kann sich auflösen.
Es stellt sich heraus, dass die Aufarbeitung schmerzhafter und tragischer Ereignisse durch Humor durchaus seine Berechtigung hat. Humor mit seinen unterschiedlichen Facetten macht handlungsfähig, schafft Distanz, erzeugt Gemeinschaft und ermächtigt schlussendlich selbst. Satire, Ironie und Spott decken auf, kritisieren Verhaltensweisen, loten Grenzen aus und können so als legitimes Mittel in Konflikten genutzt werden. Die Inszenierung lädt das Publikum deshalb ein, gemeinsam als Zuschauende über die überzeichneten Figuren, die dynamischen Rollenwechsel, die eitlen, manchmal überforderten Figuren zu lachen und gleichzeitig zu reflektieren und zu bemerken, wenn Ihnen einmal das Lachen im Halse stecken bleibt und wann vielleicht sogar die Grenzen des Humors für Sie erreicht sind.
Schlussendlich bleibt nur festzustellen, dass der Schauspieler Grünberg es in der Eröffnungsszene von Sein oder Nichtsein schon sehr treffend formuliert und keine besseren Worte zu finden sind, als die seinen: «Einen Lacher soll man nie verachten.»
Justine Wiechmann
Jüdische Witze
gesammelt von Salcia Landmann
Hitlerzeit. Parteigenosse Müller erblickt auf der Straße seinen Bekannten Kohn und sagt Neckend: «Heil Hitler!»
Kohn: «Bin ich Psychiater?»
Hitlerzeit. Kohn zu Levy: «Weißt Du den Unterschied zwischen Hitler und einem Leberkranken?»
«Nu?»
«Der eine ist leberleidend, der andere leider lebend.»
Nazideutschland. Galizischer Jude wehrt mit einem Stock die wütenden Bisse eines Wolfshundes ab. Schlagzeile in der Zeitung: «Jüdischer Hausierer beißt deutschen Schäferhund.»
Nazideutschland. Ein Schweizer besucht einen jüdischen Freund: «Wie kommst du dir vor unter den Nazis?»
«Wie ein Bandwurm: ich schlängle mich Tag und Nacht durch die braunen Massen und warte, daß ich abgeführt werde.»
SS-Kommandant zum Juden: «Wenn du errätst, welches meiner beiden Augen aus Glas ist, lass ich dich laufen.»
Der Jude: «Das linke.»
Der SS-Kommandant: «Das ist richtig! Wie hast du das so schnell erkennen können?»
Der Jude: «Es hat mich so menschlich angeschaut.»
Shylock in «Der Kaufmann von Venedig» von William Shakespeare«Hat nicht ein Jude Augen?
Hat nicht ein Jude Hände, Gliedmaßen, Werkzeuge, Sinne, Neigungen, Leidenschaften?
Mit derselben Speise genährt, mit denselben Waffen verletzt, denselben Krankheiten unterworfen, mit denselben Mitteln geheilt, gewärmt und gekältet von eben dem Winter und Sommer als ein Christ?
Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht?
Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht? Wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht?»
Impressum
HERAUSGEBER Stadttheater Bremerhaven
SPIELZEIT 2025/2026, Nr. 4
INTENDANT Lars Tietje
VERWALTUNGSDIREKTORIN Franziska Grevesmühl-von Marcard
REDAKTION Justine Wiechmann
QUELLEN
Latser, Kathy; Steinert, Heinz «Von der Schmierenkomödie zur Broadway-Show: To Be or Not To Be und der polnische Widerstand Mel Brooks’ Nazi-Spott und exzentrische Positionen» in «Lachen über Hitler - Ausschwitz-Gelächter?», edition text + kritik im Richard Boorberg Verlag GmbH&Co KG, 2003.
Koepnich, Lutz, «Komik als Waffe? Charlie Chaplin, Ernst Lubitsch und Das Dritte Reich» in «Mediale Mobilmachung II - Hollywood, Exil und Nachkrieg», Wilhelm Fink Verlag, München 2006.
Landmann, Salcia: «Jüdische Witze - Der Klassiker von Salcia Landmann», Patmos-Verlag der Schwabenverlag AG, Ostfildern, 2010.
Die Texte wurden zum Teil redaktionell gekürzt oder bearbeitet. Urheber:innen, die nicht erreicht werden konnten, werden zwecks nachträglicher Rechtsabgeltung um Nachricht gebeten.